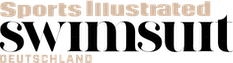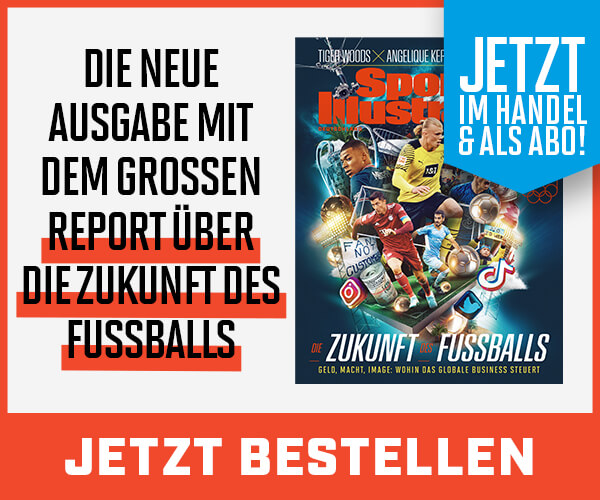"Wenn sie mich nicht kennen, wechseln manche die Straßenseite"

Es gibt nicht viele Fußball- Dokumentationen, die einen nach dem Abspann mit dem Gefühl zurücklassen, jetzt erst mal einen Schnaps zu brauchen, um das alles zu verdauen. „Schwarze Adler“, der Film, in dem Jimmy Hartwig, Gerald Asamoah und Steffi Jones – neben vielen anderen – ab 15. April (auf Amazon Prime Video) zu sehen sind, ist so eine Doku. Regisseur Torsten Körner lässt darin schwarze Fußballerinnen und Fußballer – vom ersten Afrikaner im deutschen Profi-Fußball, Guy Acolatse, bis zum heutigen Nachwuchstalent Jean-Manuel Mbom – von ihren Lebenswegen erzählen. Und vom Rassismus, dem sie dabei begegnet sind.
Was sie berichten, ist teils erschreckend, oft erhellend, nicht selten berührend. Wer die häufigen Antirassismus-Spots der Uefa zum Gähnen findet oder meint, bei dem Thema werde übertrieben, dürfte nach diesem Film seine Sichtweise überdenken. Die Dokumentation „sollte in jeder Schule gezeigt werden“, sagt Jimmy Hartwig, als wir uns für das Interview per Videokonferenz zusammenschalten. Steffi Jones und Gerald Asamoah stimmen zu. Es folgt ein anderthalbstündiges Gespräch, in dem sie eindrücklich verdeutlichen, warum.
Herr Hartwig, als Sie Anfang der 80er-Jahre mit dem HSV in München antraten, grölten Ihnen Tausende Fans entgegen, „Jimmy Hartwig, du Negerschwein“. Sie stellten sich vor sie, hoben die Hände und begannen zu dirigieren. Eine sagenhaft coole Reaktion. Nahmen Sie das wirklich so gelassen?
HARTWIG: Natürlich nicht. Aber ich hatte in meinem Leben schon so viele Schläge kassiert, dass sie mich stark genug gemacht hatten, um mich hinzustellen und zu dirigieren. Mit den Prügeln ging es bei mir ja schon im Elternhaus los …

Jimmy Hartwig wurde in Offenbach geboren. Seinen Vater, einen afroamerikanischen Soldaten, sah er nur einmal. 1972 begann er seine Profi-Karriere bei den Kickers Offenbach und wurde später mit dem HSV dreimal Deutscher Meister sowie 1983 Europapokalsieger. Für die DFB-Elf machte er nur zwei Spiele, danach wurde er nicht mehr in den Kader berufen. Heute ist er Theaterschauspieler und lebt mit seiner Familie in Inning am Ammersee.
Ihr Großvater war ein Nazi, dem nicht gefiel, dass seine Tochter ein uneheliches Kind von einem schwarzen US-Soldaten hatte. Sie haben mal gesagt: Meine Mutter musste immer aufpassen, dass mein Großvater mir als kleinem Kind kein Kissen aufs Gesicht drückt.
HARTWIG: Er hat mich fast jeden Tag geschlagen, ich ging selten ohne blutige Nase in die Schule. Diese Schläge vergesse ich nie. Und dann kämpfst du dich als Kind durch, wirst Fußball-Profi, spielst Bundesliga, schafft es sogar in die Nationalelf. Du denkst, du bist über den Berg, du denkst, das hört irgendwann auf. Die müssten doch auch langsam alle kapieren, was für ein Schwachsinn das ist, was sie da rufen. Oder? Aber nein. Und dann bin ich da hin und hab sie dirigiert. Den größten Idiotenchor der Welt. Das war herrlich.
„Cruyff sagte zu mir: ,Wärst du Holländer, hättest du schon 40 Länderspiele gemacht‘“ - Jimmy Hartwig
Sie schlugen sozusagen zurück – auf Ihre Weise.
HARTWIG: Und ich würde mir wünschen, dass mehr Menschen das tun. Auch diejenigen, die nicht direkt betroffen sind. Die schweigende Mehrheit schaltet sich auch heute noch nicht ein, wenn jemand im Stadion oder auf der Straße rassistisch beleidigt wird. Nehmen Sie das Beispiel von Jordan Torunarigha im Pokalspiel auf Schalke …
Der Hertha-Spieler wurde im Februar 2020 von Schalke-Anhängern rassistisch beleidigt. Als er später im Spiel vor Wut einen Wasserkasten vor der Schalker Ersatzbank auf den Boden knallte, bekam er die Rote Karte.
HARTWIG: Dabei ließ er nur seinen Frust raus. Er muss diesen Mist ja immer wieder hören. Was mich aber am meisten geärgert hat: dass nur zwei Spieler von seiner Mannschaft zu ihm gegangen sind und ihn in den Arm genommen haben. Zwei Spieler! Da müsste die ganze Mannschaft kommen und sagen: Du bist einer von uns! So geht’s nicht!
Vorkämpfer: Sie prägten den deutschen Fußball – und er prägte sie: Jimmy Hartwig, 66, (l.) trat 1979 als zweiter schwarzer Spieler in der Nationalelf an. Gerald Asamoah, 42, lief 2001 als erster in Afrika geborener Fußballer im DFB-Dress auf. Steffi Jones, 48, trug es zwischen 1993 und 2007 stolze 111-mal – als eine der ersten schwarzen Nationalspielerinnen.
Herr Asamoah, wenn Sie sehen, dass so etwas auch im Jahr 2020 noch passiert, was löst das in Ihnen aus?
ASAMOAH: Es macht mich wütend und traurig. Weil du immer wieder die Hoffnung hast, dass die Leute dazugelernt haben, und immer wieder enttäuscht wirst. Der Vorfall, von dem Jimmy gerade sprach: Das geschah auf Schalke, meinem Club. Ich bin seit Jahren hier und werde akzeptiert – aber ein anderer wird angemacht. Das macht mir auch Angst um meine Kinder. Die werden auf der Straße ja nicht als Asamoahs Kinder erkannt, sondern sie sind dort einfach schwarze Kinder.
Auch Ihr Sohn wurde schon beim Fußball rassistisch beleidigt.
ASAMOAH: Bei einem Spiel sagte ein Vater zu seinem Kind: „Hau den Neger um.“ Ich dachte zuerst, ich hätte mich verhört. Als ich zu ihm rüberging, erkannte er mich. „Oh, Herr Asamoah, das war nicht so gemeint …“ Ach ja? Wie war es denn gemeint? Jimmy hat Recht: Damit so etwas aufhört, brauchen wir mehr Zivilcourage. Wenn Leute bestimmte Dinge von sich geben, muss jemand dazwischengehen und sagen: „Hey, das hat hier bei uns keinen Platz.“ So wie die Fans vergangenen Februar in Münster bei dem Vorfall mit Leroy Kwadwo. Das war überragend!
Sie reagierten mit „Nazis raus!“- Rufen, als ein Zuschauer Kwadwo rassistisch beleidigte, und halfen den Ordnungskräften, den Mann zu finden.
ASAMOAH: Das war großartig. Da müssen wir hinkommen. Aber wir haben einen langen Weg vor uns.

Gerald Asamoah kam in Mampong, Ghana, zur Welt und mit zwölf Jahren nach Deutschland. Sein Profi-Debüt gab er 1996 für Hannover 96, später wechselte er zu Schalke 04, wo er heute als Lizenzspieler-Koordinator arbeitet. Er absolvierte 43 Länderspiele und nahm mit dem DFB-Team an den Weltmeisterschaften 2002 und 2006 teil. Asamoah ist Vater dreier Kinder.
Frau Jones, als Jimmy Hartwig in den 80er-Jahren den Idiotenchor dirigierte, waren Sie ein junges Mädchen, das in Frankfurt aufwuchs und in einer Jungs-Mannschaft Fußball spielte. Welche Erfahrungen haben Sie als Kind mit Diskriminierung gemacht?
JONES: Die gleichen wie so viele andere. Das ist mir jetzt, als ichden Film gesehen habe, so richtig bewusst geworden: wie viele von uns genau dasselbe erlebt haben. Dass wir wegen unserer Hautfarbe immer als anders wahrgenommen wurden. Dass unsere Mütter uns zwar sagten, es sei toll, dunkle Haut zu haben – die Deutschen fahren in den Urlaub, um auch so schön braun zu werden, hieß es immer –, dass wir uns deswegen aber oft ausgegrenzt fühlten. Dass manche von uns als Kinder sogar versuchten, sich mit Seife weiß zu waschen. Dass wir nicht verstehen konnten, wieso Menschen die Straßenseite wechselten, wenn sie uns kommen sahen. Dass unsere Eltern uns erklärten, wir müssten in der Schule doppelt so gut sein wie die anderen, damit aus uns etwas wird. Das sind alles Erfahrungen, die die meisten von uns gemacht haben. Und zum Teil auch heute noch machen. Ich bin jetzt 48 Jahre alt und stelle immer noch fest, dass mich viele Menschen nur so behandeln, wie sie mich behandeln, weil ich Steffi Jones bin und sie mich kennen. Wenn sie mich nicht kennen, wechseln manche noch immer die Straßenseite.
„Der Fußball war mein Auffangbecken. Bei Anfeindungen stand das Team zu mir. Das war prägend“ - Steffi Jones
Sie erzählen in dem Film, dass der Fußball für Sie als junges Mädchen eine Art Rettung war.
JONES: Ich bin in einem sozialen Brennpunkt aufgewachsen. Viele Freunde von mir sind später drogensüchtig geworden oder sonstwie abgedriftet. Der Fußball gab mir eine Perspektive, und meine Mannschaft war wie ein Auffangbecken für mich. Ich war als Mädchen in einem Jungs-Team erfolgreich, so konnte ich Respekt erfahren, Selbstvertrauen gewinnen. Und ob in diesem Team oder später in anderen: Wenn mich Menschen angefeindet haben, auch Gegenspielerinnen, was natürlich auch im Frauenfußball vorkommt, haben meine Mitspieler und Mitspielerinnen immer gesagt: „Steffi, wir stehen zu dir.“ Das war sehr prägend für mich.
HARTWIG: Das war bei mir ähnlich. Beim Fußball machte ich als Kind zum ersten Mal die Erfahrung, dass mir jemand vertraut und auf meiner Seite steht. Ich weiß noch, wie mein Jugendtrainer in Offenbach mal vom Vater eines Mitspielers gefragt wurde, warum der „schwarze Hartwig“ spielt und sein Sohn nicht. Da antwortete er: „Weil er besser ist.“ So etwas hatte ich noch nie erlebt. Dass mich einer verteidigt! Teamintern war ich immer integriert, weil die merkten, dass ich kicken konnte. Aber ich habe immer wieder gemerkt, dass die Eltern meiner Mitspieler darauf gelauert haben, dass ich einen Fehler mache. Ich musste immer einen Tick besser sein als die anderen.
Auch später noch, zu Profi-Zeiten?
HARTWIG: Ich musste ein Jahr lang Höchstleistungen bringen in der Bundesliga, um mal in die B-Mannschaft der Nationalelf eingeladen zu werden! Ich wurde auch nie in eine Auswahl berufen, in die Hessen-Auswahl oder so, nichts. Mein Trainer ist verzweifelt: „Das gibt’s doch nicht, was ist da los?“ Irgendwann nahm er mich zur Seite und meinte: „Was ich dir jetzt sage, ist hart, aber das ist nun mal die Zeit, in der wir leben. Du spielst da nicht, weil du keine blonden Haare hast und keine blauen Augen.“
Sie haben in Interviews immer mal wieder angedeutet, es habe nicht nur sportliche Gründe dafür gegeben, dass Jupp Derwall, der während Ihrer erfolgreichen HSV-Zeit Bundestrainer war, Sie nicht ins Nationalteam berufen hat.
HARTWIG: Schauen Sie, Anfang der 80er-Jahre hatte ich mal einen Termin auf einer Sportmesse in München, bei dem ich zufällig Johan Cruyff traf. Wir sprachen ein wenig, und er meinte: „Siehst du, wenn du Holländer wärst, dann hättest du schon 40 Länderspiele gemacht.“ Wow, dachte ich, so sieht das also einer der größten Spieler überhaupt! Eine Woche später spielte ich mit dem HSV in München, wir lagen 3 : 1 zurück, gewannen noch 4 : 3 und waren so gut wie sicher Deutscher Meister. Am Abend war ich eingeladen ins „aktuelle sportstudio“. Und wer war ebenfalls Gast an diesem Tag und saß mit mir im Flugzeug? Der Bundestrainer. Ich fasste mir ein Herz: „Herr Derwall, wissen Sie, meiner Meinung nach gehöre ich in die Nationalmannschaft.“ Darauf er: „Hartwig, bei mir bist du nicht erste Wahl.“ Ohne Begründung. Da wusste ich, hier läuft zu dieser Zeit beim Verband etwas verkehrt. Zum Glück hat sich seitdem wahnsinnig viel verändert.
JONES: Ihr wart Pioniere, Jimmy. Ihr habt die Vorarbeit für diese Veränderungen geleistet. Jetzt ist wichtig, dass die jungen Spieler, die das heute für selbstverständlich nehmen, fortführen, was ihr begonnen habt, und weiter gegen Rassismus arbeiten.
HARTWIG: Das müssen sie, Steffi. Unbedingt. Weil: Es ist leider nicht selbstverständlich, dass in der deutschen Nationalmannschaft … ich fange gleich an zu flennen, weil das wirklich … tut mir leid … (Jimmy Hartwig winkt ab, er kämpft gegen die Tränen, sammelt sich kurz).
Herr Asamoah, auch Sie haben als Spieler teils heftige rassistische Beleidigungen erlebt. Als Sie vor der Wahl standen, für die deutsche oder die ghanaische Nationalmannschaft zu spielen, entschieden Sie sich trotzdem, ohne zu zögern, für das DFB-Team. Brachten die Rassismus-Erfahrungen Sie nicht zum Zweifeln?
ASAMOAH: Da muss ich kurz ausholen. Ich kam als Zwölfjähriger nach Deutschland und kannte damals das N-Wort gar nicht. Als ich es zum ersten Mal zu hören bekam, mussten mir meine Freunde erklären, was das überhaupt heißt. In Hannover, wo ich aufwuchs, erlebte ich so ein bisschen heile Welt. Natürlich bekam ich auch mal Rassismus zu spüren, auf dem Pausenhof, in der Straßenbahn, aber ich hatte auch Freunde, fühlte mich akzeptiert. Dabei half sicher auch der Fußball. So richtig heftig konfrontiert mit Rassismus wurde ich dann zum ersten Mal bei einem Spiel mit Hannover 96 bei Energie Cottbus.
Das war 1997, Sie waren 18 Jahre alt. Zuschauer schrieen minutenlang: „Neger raus!“, Sie und Ihr Mitspieler Otto Addo wurden mit Bananen beworfen.
ASAMOAH: Es war brutal. Ich hatte so etwas noch nie erlebt. Otto und ich verstanden einfach nicht, wieso die Menschen uns gegenüber so aggressiv waren. Es war wirklich ein Schlag ins Gesicht. Aber ich funktioniere so, dass ich nach Rückschlägen wieder aufstehe und nach vorn blicke. Und das Erlebnis in Cottbus änderte nichts daran, dass ich mich in Deutschland heimisch fühlte. Als dann 2001 der Anruf von Rudi Völler kam, sagte ich aus dem Bauch heraus sofort zu. Weil dieses Land mein Zuhause ist. Es gibt hier Idioten, klar. Aber es gibt hier vor allem so viele Menschen, die mir wichtig sind, von denen ich so viel Liebe bekommen habe und denen ich auch viel verdanke. Ohne Deutschland wäre ich nicht das, was ich bin. Ich bin froh, dass ich die Entscheidung damals so getroffen habe, weil es auch eine Riesenchance war, etwas dafür zu tun, dass meine Kinder es mal einfacher haben in diesem Land.
Hatten Sie alle während Ihrer Profi-Zeit Menschen, mit denen Sie sich intensiver austauschen konnten über die Anfeindungen, die Sie erlebten? Teamkameraden, Trainer, andere schwarze Spieler?
HARTWIG: Ich habe da mit niemandem gesprochen. Ich war immer Einzelkämpfer.
JONES: Einige Trainer und Trainerinnen, die ich hatte, waren schon sehr einfühlsam und darum bemüht, dass es mir gut geht. Trotzdem habe ich auch viel mit mir selbst ausmachen müssen.
ASAMOAH: Ich musste früh lernen, selbst mit meinen Problemen klarzukommen. Meine Eltern arbeiteten viel, um Geld nach Ghana schicken zu können, und ich habe immer versucht, mit den Erfahrungen, die ich auf der Straße gemacht habe, selbst klarzukommen. Das setzte sich im Fußball fort. Über die Dinge, die mir geschahen, sprach ich mit niemandem. Ich hatte beim Thema Rassismus auch das Gefühl, dass es für viele fast ein Tabuthema war. Sie wussten nicht, was sie sagen sollten. Ein Beispiel: 2006 war ich Teil des Sommermärchens. Anderthalb Monate später wurde ich bei einem Spiel gegen Rostock rassistisch beleidigt. Da hätte ich mir gewünscht, dass mir auch mal jemand öffentlich beispringt. Aber da kam kein Satz. Ich hatte oft das Gefühl, allein dazustehen. Später war ich vor dem Sportgericht wegen eines Spiels gegen Dortmund …
Sie meinen den Vorfall im Derby gegen den BVB 2007, als Sie von Torwart Roman Weidenfeller beleidigt wurden? In den Medien hieß es, er habe Sie „schwarzes Schwein“ genannt. Er selbst bestritt, Sie rassistisch verunglimpft zu haben. Das Sportgericht des DFB sperrte ihn später für drei Spiele wegen „einer herabwürdigenden und verunglimpfenden Äußerung“.
ASAMOAH: Ich saß da allein mit meinem Anwalt vor Gericht. Auf der anderen Seite saß der Gegenpart mit Manager, Präsident und so weiter. Ich war angefeindet und beleidigt worden, aber ich hatte das Gefühl, da allein zu stehen. Es hat immer die Unterstützung gefehlt. Deswegen hat mich die „Black Lives Matter“-Bewegung sehr berührt: zu sehen, dass sich Leute mit diesem Thema befassen, wirklich verstehen, dass es Rassismus gibt. Denn es gibt ja viele Leute, die denken: „Ach, der übertreibt doch.“ Ich werde mit Bananen beworfen, ich werde als Neger beschimpft – aber ich übertreibe?
Im Mai jährt sich der Tod von George Floyd zum ersten Mal. Was ist Ihr Eindruck: Wird sich durch die daraus entstandene „Black Lives Matter“-Bewegung etwas nachhaltig verändern?
JONES: Das wird man sehen, es gab immer wieder Vorfälle, die uns alle erschüttert haben und betroffen machten. Nehmen Sie den Suizid von Robert Enke oder die rechtsterroristischen Anschläge in Deutschland in jüngerer Zeit. Darauf folgten immer großartige Aktionen, und du dachtest, das ändert grundsätzlich etwas. Aber früher oder später verfallen viele wieder in alte Muster.
„Was mir Leute an Beleidigungen schreiben, ist kaum zu fassen“ - Gerald Asamoah
Was kann man tun, damit sich nachhaltig etwas ändert?
JONES: Darüber sprechen. Von eigenen Erfahrungen erzählen. Ich habe lange gebraucht, um zu verstehen, wie wichtig es ist, dass ich meine Stimme als eine Art Botschafterin nutze. Das kann eine enorme Kraft haben. Ich gehe heute in Schulen und Kindergärten, um den Jüngsten zu vermitteln, wie verletzend es ist, wenn Menschen diskriminiert werden. Egal, ob es wegen ihrer Hautfarbe ist, ihres Gewichts, ihrer Brille oder sonst was. Wir müssen als Mehrheit dafür sorgen, dass sich die Minderheit mit all ihrer Intoleranz nicht durchsetzt.
HARTWIG: Ich wünsche mir, dass sich auch unsere Nationalspieler mehr politisch äußern. Denn die erreichen die Leute, die von der Nationalmannschaft begeistert sind und ihr Trikot tragen. Es reicht nicht, ein Schild hochzuhalten, auf dem steht: „Wir sind gegen Rassismus.“ Die Spieler müssen sich persönlich klar äußern, mit den Menschen da draußen reden, diskutieren.
ASAMOAH: Was mir dabei noch wichtig ist: dass mit uns geredet wird, statt über uns. Ich wundere mich immer, wenn irgendwo im Fernsehen Rassismus-Diskussionen stattfinden, bei denen niemand mitspricht, der davon betroffen ist. Wenn du nie rassistisch beleidigt wurdest, wirst du nie verstehen, wie sich Rassismus anfühlt und auswirkt.

Steffi Jones wurde 1972 in Frankfurt als Kind einer Deutschen und eines afroamerikanischen US-Soldaten geboren. Fußball spielte sie als Kind zunächst in einer Jungenmannschaft, mit 14 wechselte sie in ein Juniorinnenteam. Sie wurde sechsmal Deutsche Meisterin, Europa- und Weltmeisterin. Von 2016 bis 2018 trainierte Jones die Frauen-Nationalmannschaft. Heute arbeitet sie im IT-Unternehmen ihrer Frau, mit der sie in Gelsenkirchen lebt.
Es scheint ja so zu sein in der Gesellschaft: Die einen setzen sich mit dem Thema immer intensiver auseinander, auch mit Alltagsrassismus und unbewusstem Rassismus. Und dann gibt es die anderen, die immer radikaler und hemmungsloser werden. Wie erreicht man die zweite Gruppe?
ASAMOAH: Das ist schwer. Was mir Leute an Beleidigungen schrei ben, ist kaum zu fassen. Sobald ich mich zu etwas äußere, kommen Nachrichten wie: „Wenn dir das hier nicht passt, dann verpiss dich aus unserem Land!“ Übrigens immer von anonymen Fake-Accounts. Ich weiß nicht, ob man solche Leute noch erreichen kann.
HARTWIG: Diese Typen möchte ich so gerne mal von Angesicht zu Angesicht fragen: „Was hast du eigentlich gegen schwarze Menschen? Was haben die dir getan?“ Da fällt denen nichts ein. Dieser dumpfe Hass, ich denke, das wird zu Hause schon geschürt. Das ist ein Spiegelbild des Elternhauses.
JONES: Menschen, die so eine Meinung haben, sind oft auch manipuliert mit irgendwelchen Scheinargumenten: Wir seien schuld an fehlenden Arbeitsplätzen, an deren Perspektivlosigkeit oder was auch immer. Ich rede und diskutiere immer wieder mit solchen Menschen, aber es ist schwer, sie zu überzeugen. Wirklich erreichen kannst du eher junge Menschen.
ASAMOAH: Wir müssen mit den Kindern reden, sie sind die Zukunft. Wenn ich zu Hause sehe, wie meine Tochter mit ihrer Freundin spielt, einem deutschen blonden Mädchen, dann frage ich mich manchmal: Sieht sie meine Tochter anders? Oder nimmt sie sie einfach ganz normal wahr und denkt sich, das ist einfach meine Freundin? Und dann hoffe ich, dass es Letzteres ist. Das sind die Menschen, die wir erreichen können, das sind die Menschen, für die wir alle in diesem Land Vorbilder sein müssen.
Jean-Manuel Mbom, ein junger Profi von Werder Bremen, sagt im Laufe des Films, er habe sich nie weiß waschen wollen, im Gegenteil, er fände seine Hautfarbe cool.
ASAMOAH: Es gibt immer mehr Leute, die den Mund aufmachen und stolz sind. Und so muss es auch sein.
JONES: Zu sagen, ich bin stolz, schwarz zu sein, ist ein riesiger Schritt für uns. Etwas, wofür wir alle lange gebraucht haben. Dass er heute mit Überzeugung sagen kann, dass er sich wegen seiner Hautfarbe nicht schämt oder hinterfragt, das ist großartig.
Schwarze Adler - Der Dokumentarfilm von Regisseur Torsten Körner (u. a. „Angela Merkel: Die Unerwartete“) ist seit 15. April 2021 auf Amazon Prime Video zu sehen. Unter anderem kommen darin auch Patrick Owomoyela, Cacau und Erwin Kostedde zu Wort.
Das Interview wurde mit Playboy Deutschland geführt.